die basis bröckelt.
warum wissenschaftler:innen auf die barrikaden gehen.
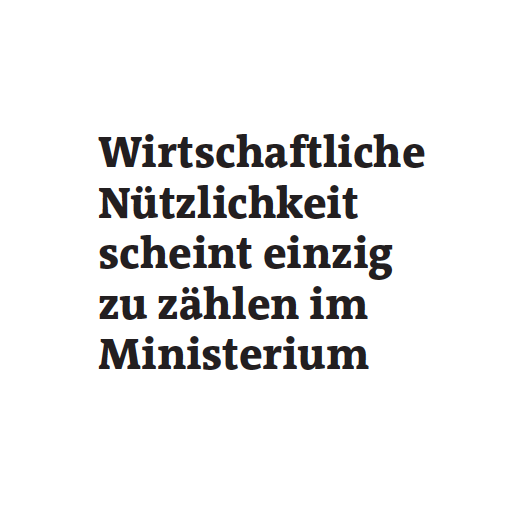
Viel Frust schlägt Bettina Stark-Watzinger (FDP), der Bundesministerin für Bildung und Forschung (BMBF), seit einigen Wochen entgegen. Und das aus der Wissenschaft, die normalerweise als eher nüchterne Klientel gilt. Der Auslöser sind weitreichende Förderstopps und eine inakzeptable (Nicht-)Kommunikation des selbst ernannten „Chancenministeriums“.
Klar ist, es wird an bestimmten Stellen gespart, aber an anderen mehr ausgegeben – etwa bei der Forschung zu Künstlicher Intelligenz. Das sind politische Entscheidungen, wie sollte es bei einem Ministerium auch anders sein? Ob das aber jeweils überzeugt und ob dies angemessen umgesetzt wird, daran gibt es in der Wissenschaft erhebliche Zweifel. Gespart werden soll zum Beispiel bei der im Sommer 2021 aufgelegten Forschungslinie zu den „gesellschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie“. Das ist politisch kurzsichtig, denn die Pandemie ist eine massive biosoziale Krise, die mit biowissenschaftlicher Expertise allein nicht gestaltbar ist. Es braucht auch und gerade sozialwissenschaftliche Forschung. Wir sprechen hier schließlich von Grundfragen gesellschaftlichen Zusammenlebens: Was ist systemrelevant? Wer ist von Gesundheit/Krankheit warum wie betroffen, und was hat das mit Ungleichheit zu tun? Welche Milieus, Gruppen, Schichten gehen wie mit einer solchen Krise um? Wie tangiert die Pandemie Familien, Wohnverhältnisse, Schulbildung, Erwerbsarbeit, Einkommen, Politik, Solidarität und vieles mehr?
Das BMBF hat aber auch bereits laufende Projekte zur Erforschung des Klimawandels, die ihre Forschungsergebnisse in den kommenden Jahren für die Öffentlichkeit aufbereiten wollten, plötzlich gekappt. Ebenso wird bei der Erforschung von Rechtsextremismus und Rassismus und bei der DDR-Forschung gespart.
Gemeinsam ist den Forschungsvorhaben, dass die Förderung vom Ministerium zunächst in Aussicht gestellt und nun kurzerhand gestoppt oder zumindest substanziell gekürzt wurde. Selbst kostenneutrale Verlängerungen von Projekten wurden kurzerhand abgelehnt. Die zunächst verunsicherten und irritierten Forschenden haben sich miteinander vernetzt und festgestellt: Das ist kein Einzelfall, das hat System. Forschungsverbünde und wissenschaftliche Fachgesellschaften wenden sich in offenen Briefen an die Ministerin, unter den Hashtags #Bewilligungsstopp, #stopthecuts und #schnellerimpact wird auf Twitter mobilisiert. Und der Protest hat sich gelohnt: Zumindest 18 der geplanten 32 Projekte in der Förderlinie „Gesellschaftliche Auswirkungen der Corona-Pandemie“ werden ab 2023 doch gefördert, wenn auch mit gekürztem Budget. Immerhin. Und doch ein Skandal.
Bisher gab es zwischen Ministerium und Wissenschaft hinreichend professionelles Vertrauen: Das Ministerium schreibt Fördermöglichkeiten zu Policy-relevanten gesellschaftlichen Herausforderungen aus, auf die sich Wissenschaftler:innen mit Expertise und Forschungsideen bewerben können. In einem hochkompetitiven Verfahren werden dann auf Basis von wissenschaftlichen Gutachten die besten Forschungsvorhaben identifiziert.
Im Anschluss an die wissenschaftliche Begutachtung wird eine Förderung zu einem bestimmten Datum in Aussicht gestellt. Bevor es aber mit der Forschungsarbeit losgehen kann, sind aufwendige organisatorische Details zu klären, einzelne Wissenschaftler:innen und Forschungseinrichtungen müssen in intensive Vorleistung gehen, und zwar in kürzester Zeit: Es müssen monatsgenaue Zeitpläne und differenzierte Budgetplanungen erstellt, Ausschreibungen veröffentlicht, Büros eingerichtet, Infrastruktur organisiert werden. Viel Aufwand also für Wissenschaftler:innen und Verwaltungen, der sich aber auszahlt, wenn dann bald und effizient mit der Forschung begonnen werden kann.
Ja, wenn. Denn als alle organisatorischen Vorbereitungen fristgerecht abgeschlossen waren und bei vielen Projekten nur noch ein formaler Bewilligungsbescheid ausstand, passierte dieses Mal: nichts. Monatelang. Der in Aussicht gestellte Starttermin der Forschungsprojekte – oftmals der 1. Juli – verstrich, und sämtliche Versuche, Informationen aus dem Ministerium zu erhalten, scheiterten. Derweil stand an den Universitäten alles bereit, die Büros waren eingerichtet, die Verträge für die Wissenschaftler:innen lagen unterschriftsbereit vor, und auch die einzustellenden Wissenschaftler:innen selbst waren da, haben andere Jobangebote abgelehnt, sind im schlimmsten Fall bereits zum neuen Arbeitsort gezogen. Erst nach Wochen des öffentlichen Protests gab es überhaupt eine Reaktion. Und Klarheit: Einige Forschungsprojekte dürfen starten – allerdings stark gekürzt und ein halbes Jahr später als geplant –, andere Forschungsprojekte werden gänzlich abgesagt. Ein Skandal ist dieses Vorgehen auch deshalb, weil gut 85 Prozent des wissenschaftlichen Personals in Deutschland befristet beschäftigt sind, vielfach über genau solche Drittmittel überhaupt bezahlt werden können. Das BMBF verstärkt mit solchem Vorgehen also die ohnehin massive Prekarität.
Welches Ziel hinter den Kürzungen steht? Auf den ersten Blick scheinen sie keinem Plan zu folgen. Es wird in den Sozialwissenschaften ebenso gekürzt wie bei den Lebenswissenschaften.
Welche Schwerpunktsetzungen das FDP-geführte Ministerium aber womöglich im Blick hat, ließ sich erahnen, als einige Förderungen mit der Begründung beendet wurden, es gebe „neue Schwerpunktsetzungen hin zu Forschungsaktivitäten, die einen schnellen Impact erzeugen“. Oder als die Ministerin im Interview mit dem Tagesspiegel zu ihren Prioritäten in der Forschungspolitik nur dahingehend konkret wurde, dass es um „neue Behandlungsmethoden, aber auch innovative Produkte“ gehe und darum, „dieses Land zur Wasserstoff-Republik“ zu machen. Oder als der kürzlich zurückgetretene Staatssekretär Thomas Sattelberger davon sprach, dass der „Hauptfokus“ nun auf „Tech-Forschung“ liegen müsse.
Die Befürchtung drängt sich auf, dass das Ministerium von Menschen geführt wird, die Impact vor allem an wirtschaftlicher Nützlichkeit messen. Schon im März – bevor das ganze Ausmaß des Bewilligungsstopps absehbar war – warnten sozialwissenschaftliche Fachverbände in einer Stellungnahme davor, sich in dieser Legislaturperiode einseitig auf „Innovationen und Transfer für den wirtschaftlichen Fortschritt“ zu beschränken. So las sich der Koalitionsvertrag, und so – wissen wir jetzt – gestaltet sich auch die politische Prioritätensetzung.
Eine Fokussierung von Forschungsförderungen auf Basis der erwarteten ökonomischen Verwertbarkeit wird der Bandbreite der gesellschaftlichen Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, nicht gerecht. Evidenzbasierte Politik im Kontext der großen Krisen unserer Zeit – etwa Corona-Pandemie, antidemokratische politische Mobilisierungen, wachsende Ungleichheit, Klimawandel, russischer Angriffskrieg – ist nur auf Basis sozialwissenschaftlicher Expertise möglich.
Anstatt Forschung auf monetär gedachte Mehrwerte und Logiken des Marktes zu verengen, müssen wir Wissenschaft auch als Analyse und Reflexion verstehen. Denn Transfer bedeutet in den Sozialwissenschaften zwar seltener, dass neue Techniken entwickelt oder Patente angemeldet wurden, kann es aber ermöglichen, die sozialen, politischen, kulturellen und ökonomischen Dynamiken in Gesellschaften zu verstehen und so zu gesellschaftlichem Fortschritt beizutragen. Keine Technologie allein wird irgendeine Krise lösen, vielmehr lösen Menschen in Gesellschaften diese Krisen, und die Sozialwissenschaften tragen dazu bei, sie dazu zu befähigen. Sozial-, übrigens auch Geisteswissenschaften sind unverzichtbare gesellschaftliche Selbstaufklärung.
Dieser Text wurde als Gastbeitrag von Paula-Irene Villa und mir im Freitag veröffentlicht.
Jule Specht ist Professorin für Persönlichkeitspsychologie an der HU Berlin und Research Fellow am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie forscht zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und zu Fragen der Politischen Psychologie.
Paula-Irene Villa ist Professorin für Allgemeine Soziologie und Gender Studies an der LMU München, seit 2021 Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Sie forscht unter anderem zu Care, Gender und Politik, Biopolitik und Sozialtheorie.
 jule specht.
jule specht.